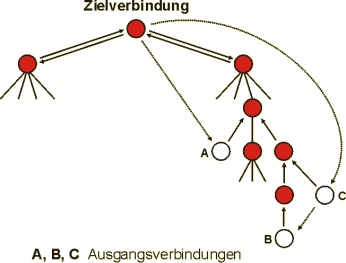Einsatz von Syntheseplanungsprogrammen
Stellt man aus heutiger Sicht einen Rückblick auf gut 35 Jahre
computergestützte Syntheseplanung an, so muß zweifelsohne
eingeräumt werden, daß die Verwendung von Syntheseplanungsprogrammen
von der eigentlichen Zielgruppe, dem im Labor arbeitenden Synthesechemiker,
nach wie vor mit größter Skepsis betrachtet wird. Ähnliches
gilt für Programmsysteme zur Reaktionsvorhersage. Ein möglicher
Grund für diese Zurückhaltung ist, daß ein Chemiker
die Planung einer organischen Synthese als seine ureigene Kompetenz
ansieht, und der Einsatz entsprechender Programme für diesen
Zweck als Einbruch in die eigene Zuständigkeit verstanden wird.
Eine der Hauptursachen für dieses Verständnis dürfte
sein, daß viele der früh entwickelten Programmkonzepte
zur Syntheseplanung tatsächlich darauf abzielten, die Synthese
einer vorgegebene Zielverbindung automatisch abzuleiten, ohne daß
der Chemiker darauf Einfluß nehmen kann/muß (z.B. SYNGEN/SYNCHEM).
Genau aus diesem Grund wird aber eine von einem Programm vorgeschlagene
Synthesestrategie von einem Chemiker als wenig transparent empfunden.
Mit anderen Programmsystemen, z.B. LHASA, kann zum Teil zwar in
interaktiver Weise an der Synthesestrategie einer Verbindung gearbeitet
werden, allerdings wird dem Chemiker oft eine starre Abfolge aufgezwungen,
wie er die Methoden des Programms anzuwenden hat. Dies entspricht
aber nicht der natürlichen Vorgehensweise eines Chemikers bei
der Planung einer Synthese. Vielmehr versucht dieser häufig,
zunächst ihm bekannte Ausgangsverbindungen in der Zielverbindung
zu erkennen, um von dort aus wieder in Richtung seines Syntheseziels
zu gelangen.
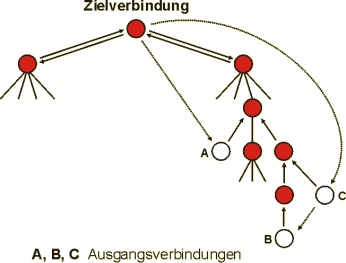
Bidirektionale Suche nach einer geeigneten Synthesestrategie. Die Synthesestrategie
wird sowohl von der Zielverbindung als auch von bereits erkannten Ausgangsmaterialien
her versucht
Diese bidirektionale Suche nach der geeigneten Synthesestrategie besteht zunächst
aus einem losen Netzwerk, das zwischen der Zielverbindung, verfügbaren
Ausgangsmaterialien, noch nicht präzisierten Intermediaten sowie bekannten
Syntheseschritten gespannt wird. Um die Synthesestrategie vollständig auszuarbeiten,
wird dieses Netzwerk Schritt für Schritt verfeinert und überarbeitet,
bis alle Lücken gefüllt sind.
Ein weiteres typisches Merkmal von Syntheseplanungsprogrammen ist es, daß
sie für ihr chemisches Wissen auf Wissensbasen zurückgreifen. Diese
Wissensbasen werden auf unterschiedliche Weise durch Interpretation und Wissensextraktion
aus gemessenen experimentellen Daten oder bekannten Reaktionen aufgebaut und
enthalten sämtliche ihrer Informationen in sehr generalisierter Form. Das
heißt andererseits, daß vor allem für einen Chemiker, der das
Programm später anwenden will, nicht immer nachvollziehbar ist, welche
konkreten Informationen sich hinter jedem Eintrag der Wissensbasis verbergen.
Macht das Programm einen Vorschlag auf Grundlage seiner Wissensbasis, stellt
sich auch hier für den Chemiker oft ein Gefühl mangelnder Transparenz
ein. Ein weiteres häufiges Problem in der Verwendung von Wissensbasen ist
es, daß ihre Einträge oft systematisch auf ein Syntheseziel angewendet
werden. Dies führt oft zu breiten und nicht ausbalancierten Synthesebäumen,
deren Informationsgehalt nur schwer zu überblicken ist.
© Prof. Dr. J. Gasteiger, Dr. Th. Engel, M. Sitzmann, CCC Univ. Erlangen, Thu Apr 22 13:31:25 2004 GMT
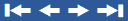 BMBF-Leitprojekt Vernetztes Studium - Chemie BMBF-Leitprojekt Vernetztes Studium - Chemie
|

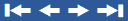
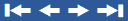 BMBF-Leitprojekt Vernetztes Studium - Chemie
BMBF-Leitprojekt Vernetztes Studium - Chemie